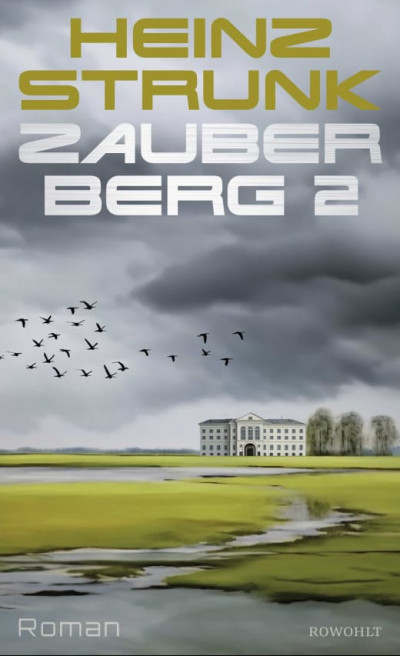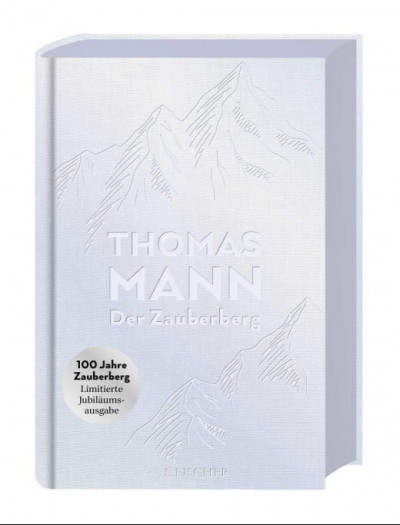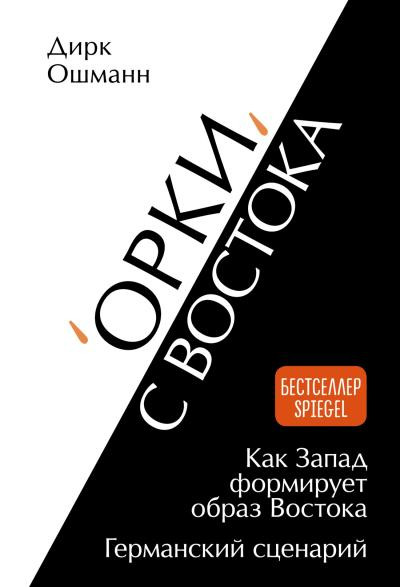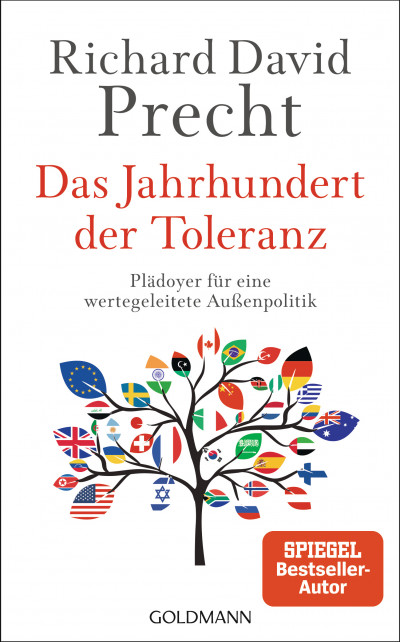Gestern besichtigte ich völlig unbeabsichtigt eine hübsche Wohnung. Und das kam so: Statt zum See, radelte ich gegen Abend durch die sommerlich leere Stadt, zuerst zum Friedhof, um nach dem Grab meiner Mutter zu sehen, dann durch das angrenzende Viertel mit kleinen Villen, die im Schatten von Platanen und dem Völkerschlachtdenkmal liegen.
Vor einem Haus blieb ich stehen, denn seine Fenster fielen mir besonders auf. Das ganze untere Stockwerk hatte eine Art Kirchenfenster: kleinteilige Bleiverglasung, reich verzierte, zart eingefärbte, undurchsichtige Scheiben. Ich betrachtete sie und überlegte, warum der Hauseigentümer sich derart verbarrikadierte, oder ob sich in diesem Gebäude vielleicht eine Kirche verbarg, als ein Auto neben mit hielt.
Das Fenster auf der Fahrerseite glitt hinunter und ein freundlich aussehender, mittelalter Mann fragte, ob ich Interesse an der Wohnung hätte. Da erst bemerkte ich einen kleinen Aushang am kunstvoll geschmiedeten Zaun: „Wohnung zu vermieten“. Ich sagte ja, ich hätte Interesse.
Aus dem Auto sprang, oder treffender gesagt, stieg ein Hund aus, wie man ihn gewöhnlich auf Gobellains aus dem 19. Jahrhundert findet (dort allerdings meist paarweise auftretend): groß und spindeldürr, die Schnauze dünn und lang, eine Art ausgemergelter Ameisenbär, das Fell sparsam, und mittellang, ein wenig an eine mit feinen Fransen verzierte Damasttischdecke erinnernd. Dieses seltsame Tier war weiß und naß, als hätte es soeben im See oder in einem Springbrunnen gebadet. Es kam auf mich zu wie in Zeitlupe, geräuschlos; vollführte die Andeutung einer Beschnupperung und schwebte auf seinen Stäbchenbeinen durch die filigrane Pforte in den Villengarten, wie ein Gespenst. Es roch nicht einmal nach nassem Hund. Auch habe ich keine Zunge wahr genommen.
Die mir gezeigte Wohnung war sehr schön, die ganze erste Etage, die Zimmer wie Blütenblätter um die Diele angeordnet, der Balkon imposant.
Was für ein schöner Garten! rief ich, auf den Balkon tretend. So überraschend hell, sprach ich weiter, wenn man all die Platanen bedenkt, die die Gegend beschatten.
Ja, sagte der Mann, aber für Sie wäre nur der Blick von diesem wunderbaren Balkon relevant. Das schöne dabei ist, Sie hätten auch keinerlei Arbeit mit dem Garten, denn den bestellt meine Frau und er ist ausschließlich zu unserer eigenen Nutzung gedacht.
Und ich dachte: Wozu so weit aus der Innenstadt wegziehen, wenn man sich nicht einmal mit einem Buch in den Garten setzen darf, oder die Blumen aus der Nähe betrachten und an ihnen riechen?
Wenn ich ein Diorama sehen möchte, dann besuche ich das Naturkundemuseum...
Das sagte ich aber nicht laut, ich bin gut erzogen, und außerdem beschäftigte mich gerade eine andere Frage. Wenn der Hausbesitzer, der die untere Etage bewohnt, die ganze Fensterfront undurchsichtig gestaltete, warum ließ er sein Leben gartenwärts derart betrachten?
Denn der Garten lag wie eine Freilichtbühne bis ins letzte Winkel einsehbar – für die Mieter des ersten Stocks und ebenfalls für die in der darüber liegenden kleinen Dachwohnung.
Sollten die Mieter dem fremden Leben lauschen und zuschauen? War das Absicht? Und falls ja, warum?
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
Zeichen und Wunder
Wo der Gast König ist
Gips zu Geld machen
Die Geschäftsidee
Ferien ohne Männer
Männer in den Kirschen
Der Taucher
Sonst keine Probleme
Berlusconis Haare
Blut und Schokolade
Häusliche Unfälle
Schutz, der keiner ist
Verheiratete leben länger!
Verliebt, verlobt, verheiratet
Wer hat schon das Leben, das er sich wünscht?
Aktuelles
„Blood of Hercules“ von Jasmine Mas – Dark Romantasy trifft Mythos und Macht
„Nebel und Feuer“ von Katja Riemann – Wie vier Frauen inmitten der Krisen unserer Zeit Gemeinschaft, Mut und Sinn finden
Der Pinguin meines Lebens – von Tom Michell - Buch & Filmstart 2025: Rezension einer besonderen Freundschaft
„Mama, bitte lern Deutsch“ von Tahsim Durgun – TikTok trifft Literatur
"The Loop – Das Ende der Menschlichkeit“ von Ben Oliver: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz den Wert des Lebens bestimmt?
„Déjà-vu“ von Martin Walker – Brunos siebzehnter Fall und die Schatten der Geschichte
„Der Besuch der alten Dame“ – Wie Dürrenmatts Klassiker den Preis der Moral entlarvt
„Der Hundebeschützer“ von Bruno Jelovic – Wie aus einem Fitnessmodel ein Lebensretter für Straßenhunde wurde
Für Martin Suter Fans: „Wut und Liebe“ -Wenn Gefühle nicht reichen und Geld alles verändert
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ – Warum Andreas Steinhöfels Kinderbuchklassiker so klug, witzig und zeitlos ist
Abschied: Peter von Matt ist tot
„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt
„Hunger und Zorn“ von Alice Renard – Was der stille Debütroman über Einsamkeit und Empathie erzählt
»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht
Ein Haus für Helene
Rezensionen
„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit
„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch
„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks
„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe
„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch
Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen
„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt
„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft
Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen