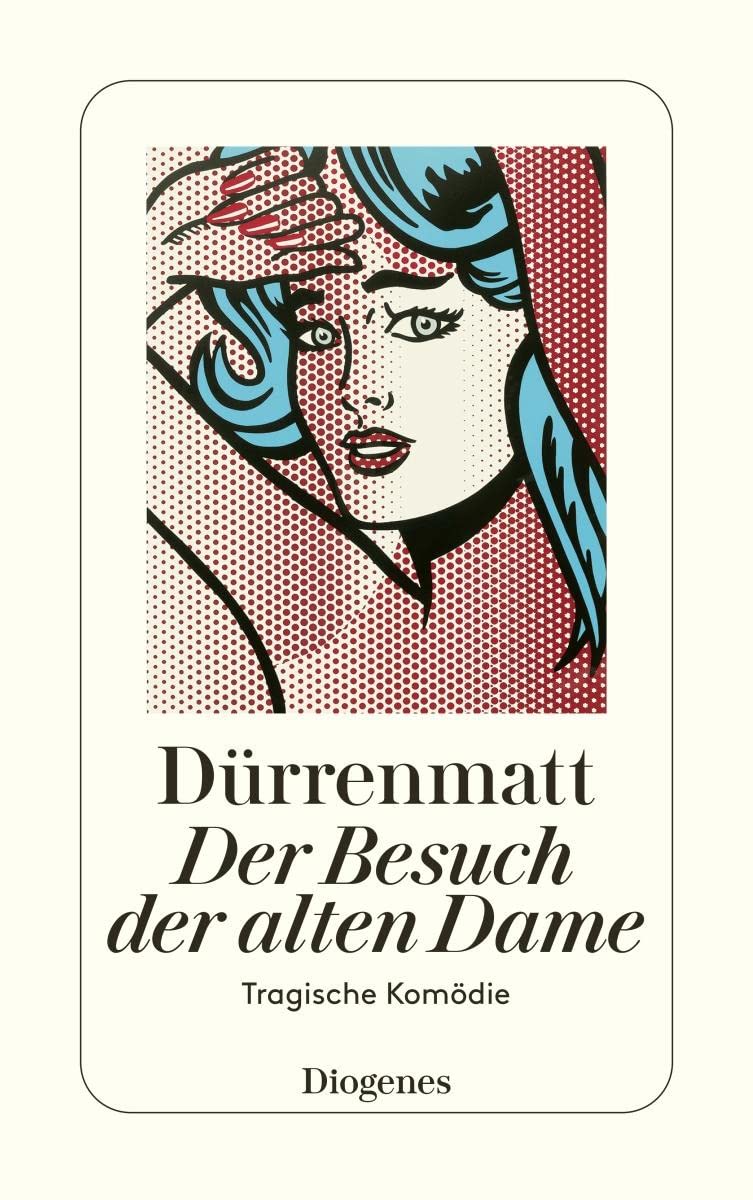Friedrich Dürrenmatt schrieb mit „Der Besuch der alten Dame“ nicht einfach ein Theaterstück. Er entwarf eine moralische Versuchsanordnung, die heute aktueller wirkt denn je: Was passiert mit einer Gemeinschaft, wenn Geld über Gerechtigkeit gestellt wird? Und wie schnell kippt öffentliche Empörung in stillschweigende Komplizenschaft? In seiner 1956 uraufgeführten Tragikomödie schildert Dürrenmatt mit bitterer Ironie den langsamen moralischen Verfall einer Stadt – und schafft ein Werk, das bis heute fesselt, provoziert und entlarvt.
„Der Besuch der alten Dame“ – Wie Dürrenmatts Klassiker den Preis der Moral entlarvt
Worum geht es in „Der Besuch der alten Dame“?
In der heruntergekommenen Kleinstadt Güllen scheint jede Hoffnung verloren – bis die Multimilliardärin Claire Zachanassian in ihre Heimat zurückkehrt. Die Güllener wittern ihre Chance: Claire, einst in Armut aus der Stadt vertrieben, könnte mit einer großzügigen Spende alle retten.
Und tatsächlich: Claire bietet der Stadt eine Milliarde – 500 Millionen für die Stadt, 500 für deren Bürger. Doch die Bedingung hat es in sich: Sie fordert Gerechtigkeit für das, was ihr angetan wurde. Alfred Ill, einst ihr Liebhaber, hatte sie schwanger sitzen lassen und mithilfe bestochener Zeugen ihre Ehre ruiniert. Dafür verlangt Claire nun seinen Tod.
Die Bürger Güllens sind empört. Zunächst. Doch mit jedem neuen Paar Schuhe, jeder Ratenzahlung, jeder „kleinen Investition“ wächst ihre Bereitschaft, Claires Forderung zu erfüllen. Was folgt, ist kein plötzlicher Pakt – sondern eine kollektive Gewöhnung an Unrecht, das am Ende tödlich wird.
Welche Themen und Motive behandelt das Drama?
Dürrenmatt nutzt seine Figuren nicht als Träger ideologischer Positionen – sondern als Spiegel kollektiver Prozesse. Die zentralen Themen:
-
Moral vs. ökonomisches Interesse: Wie viel ist ein Leben wert, wenn damit Wohlstand für viele erkauft werden kann?
-
Vergeltung und Gerechtigkeit: Ist Claires Forderung Rache – oder eine Form moralischer Wiedergutmachung?
-
Korrumpierbarkeit: Der Roman zeigt, wie einfach es ist, Prinzipien aufzugeben – nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Alltag, Pragmatismus, Druck.
-
Kollektive Schuld: Nicht ein Täter steht am Ende auf der Bühne, sondern eine ganze Gesellschaft, die tötet – ohne Messer, aber mit Absicht.
Besonders klug: Die Entscheidung wird nie offen ausgesprochen. Ill wird getötet, aber keiner sagt: „Ich tue es.“ Die Tat passiert – und bleibt doch anonym. Genau hier liegt die eigentliche Tragik des Stücks.
Wie funktioniert die Sprache und Struktur von Dürrenmatts Stück?
Dürrenmatt schreibt keine naturalistischen Dialoge – seine Sprache ist reduziert, pointiert, fast formelhaft. Der Aufbau ist klar in drei Akte gegliedert, wobei der moralische Niedergang der Stadt Schritt für Schritt nachvollziehbar gemacht wird.
Ein zentrales stilistisches Mittel ist der Kontrast: Das scheinbar Groteske (Claire mit ihrem Sargträger-Gefolge, Prothesen, Panther) trifft auf eine betont biedere Stadtkulisse. Der Effekt: Die Absurdität der Handlung wird ins Reale hineingeschrieben – nicht umgekehrt.
Claire Zachanassian und Alfred Ill – Figuren mit Abgrund
Claire ist keine einfache Rächerin. Sie ist reich, eiskalt, aber nicht herzlos. Ihre Geste ist grausam – aber sie erwächst aus erfahrenem Unrecht. Dass sie ihre Menschlichkeit nicht offen zeigt, macht sie zu einer der ambivalentesten Frauenfiguren der deutschsprachigen Literatur.
Alfred Ill dagegen ist keine klassische Identifikationsfigur. Er war Täter – und ist am Ende Opfer. Sein Schuldgeständnis ist still, aber glaubwürdig. Die Würde, mit der er am Ende in den Tod geht, hebt ihn auf eine fast tragische Ebene.
Warum wird „Der Besuch der alten Dame“ heute noch gelesen – und gespielt?
Die Fragen, die Dürrenmatt stellt, sind zeitlos – und durch die moderne Mediengesellschaft vielleicht sogar noch relevanter geworden:
-
Wie leichtfertig geben Menschen Grundsätze auf, wenn der Preis stimmt?
-
Welche Narrative nutzen Gemeinschaften, um sich von Schuld reinzuwaschen?
-
Ist Gerechtigkeit käuflich – oder ist der Markt längst moralisch geworden?
Das Stück hat in Schulen, auf Bühnen und in politischen Debatten einen festen Platz – nicht, weil es belehrt, sondern weil es provoziert.
Für wen ist dieses Stück relevant – auch über den Unterricht hinaus?
Ursprünglich im schulischen Kontext weit verbreitet, entfaltet „Der Besuch der alten Dame“ auch für ein erwachsenes Publikum seine volle Kraft. Es eignet sich für:
-
Literaturinteressierte, die gesellschaftliche Dynamiken in fiktionaler Form analysieren wollen
-
Theaterliebhaber, die starke Figuren und dichte Dialoge schätzen
-
Ethiker, Soziologen, Lehrer, Debattenführer – kurz: alle, die sich für den Zusammenhang von Moral und Macht interessieren
Was lässt uns „Der Besuch der alten Dame“ über uns selbst erkennen?
Dürrenmatt zwingt sein Publikum, sich zu fragen: Was würde ich tun? Wie viel „Empörung“ bleibt, wenn es plötzlich um den eigenen Vorteil geht?
Das Stück hält der Gesellschaft keinen Spiegel vors Gesicht – es ist selbst der Spiegel. Wer hinsieht, erkennt darin nicht nur die Güllener, sondern auch moderne Stadtgesellschaften, Unternehmen, politische Systeme. Die Erkenntnis: Schuld ist nie nur individuell – sie ist strukturell möglich. Und das macht sie so gefährlich.
Über Friedrich Dürrenmatt – Wer war der Mann hinter der Tragikomödie?
Geboren 1921 in der Schweiz, war Friedrich Dürrenmatt Schriftsteller, Dramatiker, Denker. Neben „Der Besuch der alten Dame“ schrieb er u. a. „Die Physiker“ und „Der Richter und sein Henker“. Seine Texte sind geprägt von moralischer Klarheit, struktureller Schärfe und einer Lust an Paradoxien. Dürrenmatt glaubte an die Kraft der Literatur – nicht als Lösung, sondern als Frage.
Er starb 1990, doch seine Stücke gehören heute zum festen Repertoire europäischer Bühnen – nicht nur, weil sie gut geschrieben sind. Sondern weil sie uns betreffen.
Ein Theaterstück als moralisches Experiment – klug, bitter und erschreckend aktuell
„Der Besuch der alten Dame“ ist mehr als Literatur. Es ist ein Test: für Figuren, für Leser, für Gesellschaften. Wer sich darauf einlässt, liest keine Geschichte – sondern erlebt eine Entscheidung, die nie nur die anderen trifft.
Ein Stück, das zeigt: Gerechtigkeit hat einen Preis. Und jeder entscheidet mit, ob er ihn zahlen will – oder kassieren.
Hier bestellen
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe
"Jean Barois" von Roger Martin du Gard – Ein Roman über Wahrheit, Ideale und den Zerfall der Gewissheiten
Der Verschollene
Der Steppenwolf - das Kultbuch der Hippie-Generation
Die feuerrote Friederike
Aktuelles
"The Loop – Das Ende der Menschlichkeit“ von Ben Oliver: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz den Wert des Lebens bestimmt?
„Déjà-vu“ von Martin Walker – Brunos siebzehnter Fall und die Schatten der Geschichte
„Der Besuch der alten Dame“ – Wie Dürrenmatts Klassiker den Preis der Moral entlarvt
„Der Hundebeschützer“ von Bruno Jelovic – Wie aus einem Fitnessmodel ein Lebensretter für Straßenhunde wurde
Für Martin Suter Fans: „Wut und Liebe“ -Wenn Gefühle nicht reichen und Geld alles verändert
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ – Warum Andreas Steinhöfels Kinderbuchklassiker so klug, witzig und zeitlos ist
Abschied: Peter von Matt ist tot
„Hoffe: Die Autobiografie“ von Papst Franziskus – Was sein Leben über die Welt von heute erzählt
„Hunger und Zorn“ von Alice Renard – Was der stille Debütroman über Einsamkeit und Empathie erzählt
»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht
Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz
Rezensionen
„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit
„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch
„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks
„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe
„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch
Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen
„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt
„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft
„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note
Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft
Guadalupe Nettel: Die Tochter
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen