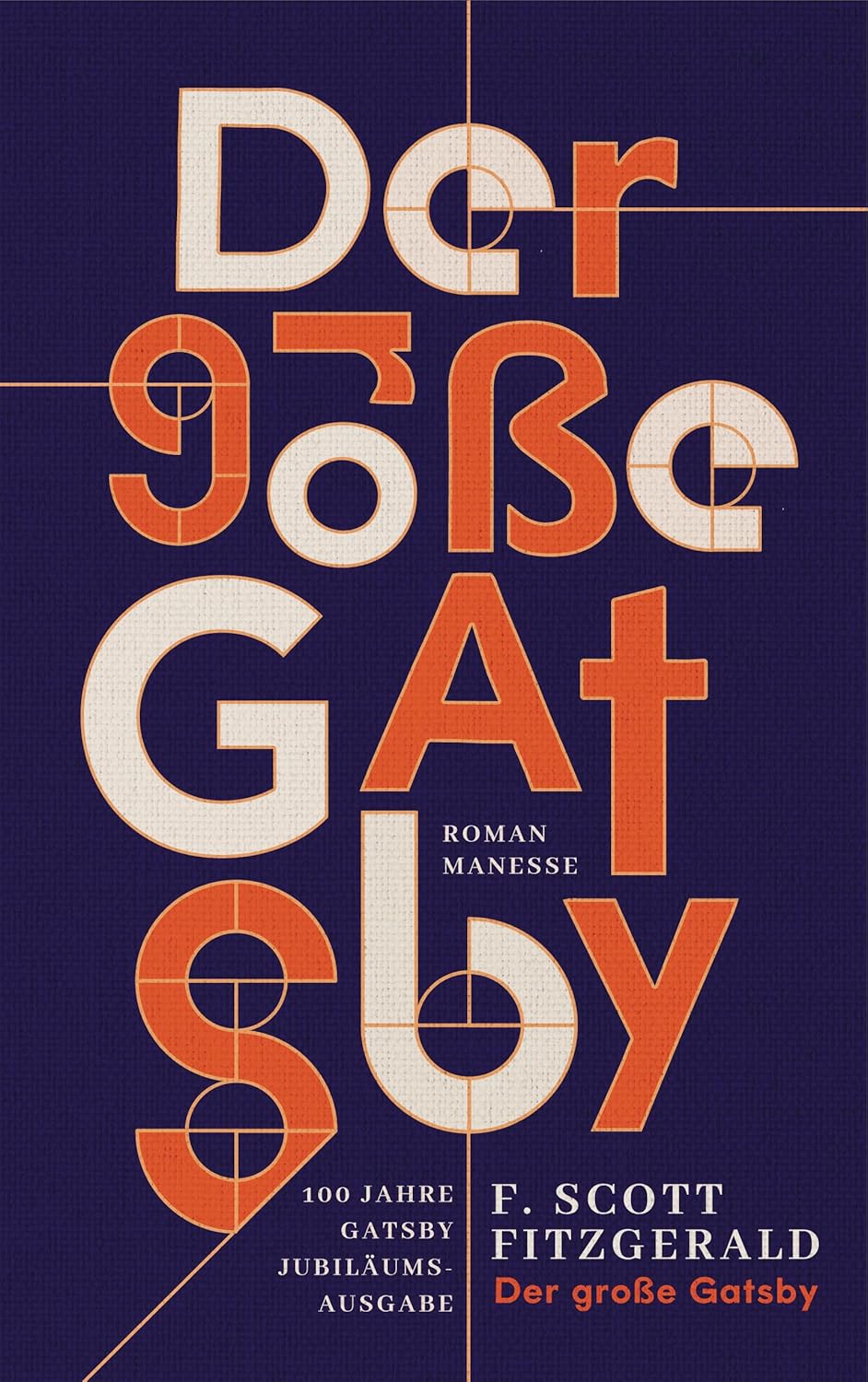Anzeige
Ein Jahrhundert ist vergangen, seit Jay Gatsby seine Partys gegeben hat – opulent, maßlos, blendend – und doch tief durchdrungen von Einsamkeit. Hundert Jahre später, mit der Ruhe und Distanz eines europäischen Blicks, fragt man sich: Was erzählt uns dieses Buch noch, in Zeiten algorithmischer Selbstvermarktung, digitaler Parallelbiografien und globaler Ungleichheit?
Der Roman, der 1925 in einer sich selbst feiernden, postpandemischen Gesellschaft erschien, wirkt wie eine prophetische Studie über das Scheitern jener Illusion, die sich als „amerikanischer Traum“ tarnt – ein Begriff, der in europäischen Ohren ohnehin stets einen leichten Hall von Selbsttäuschung hat.
Zwischen Jazz und Leere
Eine Geschichte von Sehnsucht, Inszenierung und dem trügerischen Glanz der Oberfläche
Die Geschichte wird aus der Perspektive von Nick Carraway erzählt, einem jungen Mann aus dem amerikanischen Mittelwesten, der 1922 nach New York kommt, um im Börsengeschäft Fuß zu fassen. Er mietet ein bescheidenes Häuschen in West Egg, Long Island – einem Ort für neue Reiche –, und beobachtet bald die exzentrischen Feste seines Nachbarn Jay Gatsby, eines geheimnisvollen Millionärs mit zweifelhafter Herkunft und großem Stil.
Ein Mann mit Vergangenheit
Niemand scheint zu wissen, wer Gatsby wirklich ist. Gerüchte kursieren: Er sei ein deutscher Spion gewesen, ein Mörder, ein Oxford-Absolvent. Doch hinter der blendenden Fassade seiner Partys – zu denen halb New York strömt, ohne je eingeladen zu sein – verbirgt sich eine obsessive, beinahe tragische Hoffnung: Gatsby will seine verlorene Liebe Daisy Buchanan zurückgewinnen, Nicks Cousine, die inzwischen mit dem wohlhabenden, aber hohlstolzen Tom Buchanan in East Egg lebt – der Welt des „alten Geldes“, geprägt von Exklusivität und Standesdünkel.
Wiedersehen und Illusion
Nick arrangiert ein Wiedersehen zwischen Gatsby und Daisy. Die alte Leidenschaft flammt neu auf. Gatsby glaubt daran, alles rückgängig machen zu können – so, als wäre keine Zeit vergangen. Doch Daisy ist keine Figur seiner Erinnerung, sondern eine Frau, deren Leben längst eine andere Richtung genommen hat. Der Versuch, das Vergangene wiederzubeleben, scheitert nicht nur an den äußeren Umständen, sondern an Gatsbys Weigerung, die Realität zu akzeptieren.
Konflikt und Eskalation
Ein dramatisches Wochenende in Manhattan bringt die Konflikte auf den Höhepunkt: Tom demaskiert Gatsby vor Daisy, enthüllt seine illegalen Geschäfte und stellt seine soziale Unwürdigkeit bloß. Daisy zieht sich daraufhin zurück – innerlich wie äußerlich. Gatsby, der weiterhin glaubt, dass sie sich zu ihm bekennen wird, wartet vergeblich vor ihrem Haus.
Auf der Rückfahrt kommt es zur Katastrophe: Myrtle Wilson, Toms Geliebte, wird von Daisys Auto überfahren – Gatsby übernimmt aus Liebe die Schuld. Doch statt Dank oder Schutz erfährt er Verrat. Daisy kehrt zu Tom zurück, und Gatsby wird wenig später von George Wilson, Myrtles Ehemann, erschossen – ein Akt aus Verzweiflung und Täuschung.
Ende der Geschichte, Ende eines Traums
Nick, entsetzt über den moralischen Verfall der Menschen um ihn herum, versucht Gatsbys Beerdigung zu organisieren – vergeblich. Niemand kommt. Die Partygäste bleiben fort, Freunde gibt es keine. Am Ende bleibt Nick allein zurück – ernüchtert, verletzt, desillusioniert. Er verlässt New York und kehrt in den Westen zurück.
Fitzgeralds Stil: Ein Tanz auf dünnem Eis
Fitzgerald schreibt, wie jemand schreibt, der zu viel gesehen und zu früh gelitten hat. Seine Sprache changiert zwischen funkelnder Oberfläche und melancholischer Tiefe. Er malt mit den Mitteln des Impressionismus – Lichtreflexe auf Cocktailgläsern, Gespräche in verrauchten Salons, eine Hand, die sich in der Luft verliert. Und darunter stets: die Leere.
Wer aus europäischer Perspektive auf diesen Roman blickt, erkennt schnell: Fitzgerald ist näher an Proust als an Hemingway. Sein Gatsby ist kein Held, sondern eine Projektion – ein Mann, der aus sich selbst eine Geschichte macht, weil die Wirklichkeit ihn nicht trägt. Er glaubt an den Neuanfang, doch seine Vergangenheit bleibt klebrig an ihm haften wie der Champagnergeruch an den Wänden seiner Villa.
Das 20. Jahrhundert im Brennglas
„Der große Gatsby“ ist nicht nur ein Porträt des Jazz Age – es ist ein Dokument des Umbruchs. Die alte Gesellschaftsordnung bröckelt, neue Reichtümer entstehen, doch sie bleiben ohne Anker. Europa kennt solche Brüche zur Genüge – das Auseinanderfallen von Werten und Wirklichkeit, von Glaube und Geschichte. Fitzgerald, der sich selbst als Schriftsteller der „verlorenen Generation“ verstand, schreibt mitten hinein in diesen Zwischenraum.
Gatsby ist der Amerikaner, der glaubt, sich neu erfinden zu können. Aber aus europäischer Sicht, geprägt von Jahrhunderten der Verflechtungen, von genealogischer Beharrlichkeit und kultureller Tiefe, wirkt dieser Glaube fast tragikomisch. Die aristokratische Daisy, so leer sie auch gezeichnet ist, wird bei Fitzgerald nie einfach zur Projektionsfläche – sie ist auch ein Echo auf eine alte Ordnung, die nur scheinbar verschwunden ist.
Und heute?
Hundert Jahre später leuchten Gatsbys Partys in anderen Farben. Heute feiern wir uns auf Social Media, definieren Erfolg über Sichtbarkeit, nicht über Substanz. Der neue Gatsby lebt vielleicht in einer Villa auf Ibiza, besitzt eine KI-Firma und spricht in Metaphern über Blockchain. Aber der Traum ist der gleiche: gesehen werden, Bedeutung haben, geliebt werden – koste es, was es wolle.
Der Roman wirkt heute wie eine Warnung: vor der Verwechslung von Schein und Sein, vor der sentimentalen Rückwärtsgewandtheit, die sich Fortschritt nennt. In einer Zeit, in der Politik wie Popkultur zunehmend von Narrativen geprägt sind, wird „Der große Gatsby“ zu einer Parabel über die Macht der Selbsterzählung – und deren tödliche Konsequenzen.
Ein Klassiker ohne Verfallsdatum
Man kann diesem Roman seine Schwächen nicht absprechen: Die Frauenfiguren sind schemenhaft, die Nebencharaktere manchmal karikaturenhaft. Doch darin liegt vielleicht auch eine bittere Wahrheit über die Gesellschaft, die Fitzgerald beschreibt. Eine Welt, in der jeder seinen Platz kennt – und in der niemand wirklich ausbricht, nicht einmal Gatsby.
„Der große Gatsby“ bleibt ein glitzerndes, trauriges, präzise gebautes Requiem auf den Traum vom Glück durch Besitz. Und wie bei jeder großen Literatur geht es nicht um die Zeit, in der sie geschrieben wurde – sondern um die Zeit, in der wir sie lesen.
Der Autor: F. Scott Fitzgerald
Ein Kind der Ambivalenz. Fitzgerald lebte wie seine Figuren – zwischen Aufstieg und Selbstzerstörung. Seine Ehe mit Zelda Sayre war legendär und katastrophal. Alkoholismus, Geldnot, literarischer Ruhm und Verfall – er kannte beides. 1940 stirbt er, vergessen, verarmt, bevor sein Werk neu entdeckt wird. Seine Geschichte ist selbst ein Roman – einer, der viel über das 20. Jahrhundert erzählt. Und über die Träume, die uns zum Scheitern verurteilen, wenn wir ihnen blind folgen.
Weitere Romane von F. Scott Fitzgerald
Hier eine Liste seiner weiteren wichtigen Werke, die thematisch und stilistisch oft mit Gatsby in Verbindung stehen:
-
This Side of Paradise (Diesseits vom Paradies, 1920)
– Fitzgeralds Debütroman, stark autobiographisch, Generation der „jungen Rebellen“ nach dem Ersten Weltkrieg. -
The Beautiful and Damned (Die Schönen und Verdammten, 1922)
– Porträt eines glamourösen, aber zerrütteten Paares im New York der 1910er Jahre. -
Tender Is the Night (Zärtlich ist die Nacht, 1934)
– Psychologisch dichter Roman über Liebe, Wahnsinn und Dekadenz an der Riviera. -
The Last Tycoon (Der letzte Tycoon, posthum 1941, unvollendet)
– Einblicke in Hollywood, basierend auf Fitzgeralds Erfahrungen als Drehbuchautor.
Hier bestellen
Anzeige
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
Guadalupe Nettel: Die Tochter
„Ghost Mountain“ von Rónán Hession – Eine stille Hymne auf Menschlichkeit und Gemeinschaft
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen
Rezension: „In der Gnade“ von Joy Williams – Ein literarischer Geheimtipp über Verlust, Glaube und das Erwachsenwerden

„In der Gnade“ von Joy Williams – Eine literarische Meditation über Verlust, Glaube und innere Leere
"Das Bücherschiff des Monsieur Perdu" von Nina George
„Ein Leben für die Avantgarde – Die Geschichte von Gabriële Buffet Picabia“ von Anne und Claire Berest
„Du lebst falsch! Eine philosophische Provokation“ von Wilhelm Reichart – Inspirierende Denkanstöße oder weltfremde Gesellschaftskritik?
„A Man’s Job“ von Edith Anderson – Ein feministischer Klassiker neu entdeckt
"Jean Barois" von Roger Martin du Gard – Ein Roman über Wahrheit, Ideale und den Zerfall der Gewissheiten
„Das Kreuz“ von Stefan Zweig – Eine kraftvolle Erzählung über Schuld, Reue und Menschlichkeit
„Die Yacht“ von Sarah Goodwin – Luxus, Lügen und ein tödlicher Törn
„Diese brennende Leere“ von Jorge Comensal – Wenn die Zukunft in Flammen steht
„HEN NA E – Seltsame Bilder“ von Uketsu – Wenn Bilder mehr sagen als Worte
Aktuelles
Guadalupe Nettel: Die Tochter
"ttt – titel thesen temperamente" am Sonntag: Zwischen Wehrpflicht und Widerstand – Ole Nymoen im Gespräch
„Ghost Mountain“ von Rónán Hession – Eine stille Hymne auf Menschlichkeit und Gemeinschaft
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Siegfried Unseld und das Schweigen: Eine deutsche Karriere
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
Joachim Unseld erhält den „Ordre des Arts et des Lettres“
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen
Rezension: „In der Gnade“ von Joy Williams – Ein literarischer Geheimtipp über Verlust, Glaube und das Erwachsenwerden
BookBeat meldet Rekordwachstum im ersten Quartal 2025 – Nachfrage nach Hörbüchern boomt weiter
Andreas Sommer – Drachenberg
Ulrike Kolb erhält den Kunstpreis des Saarlandes 2024 für Literatur