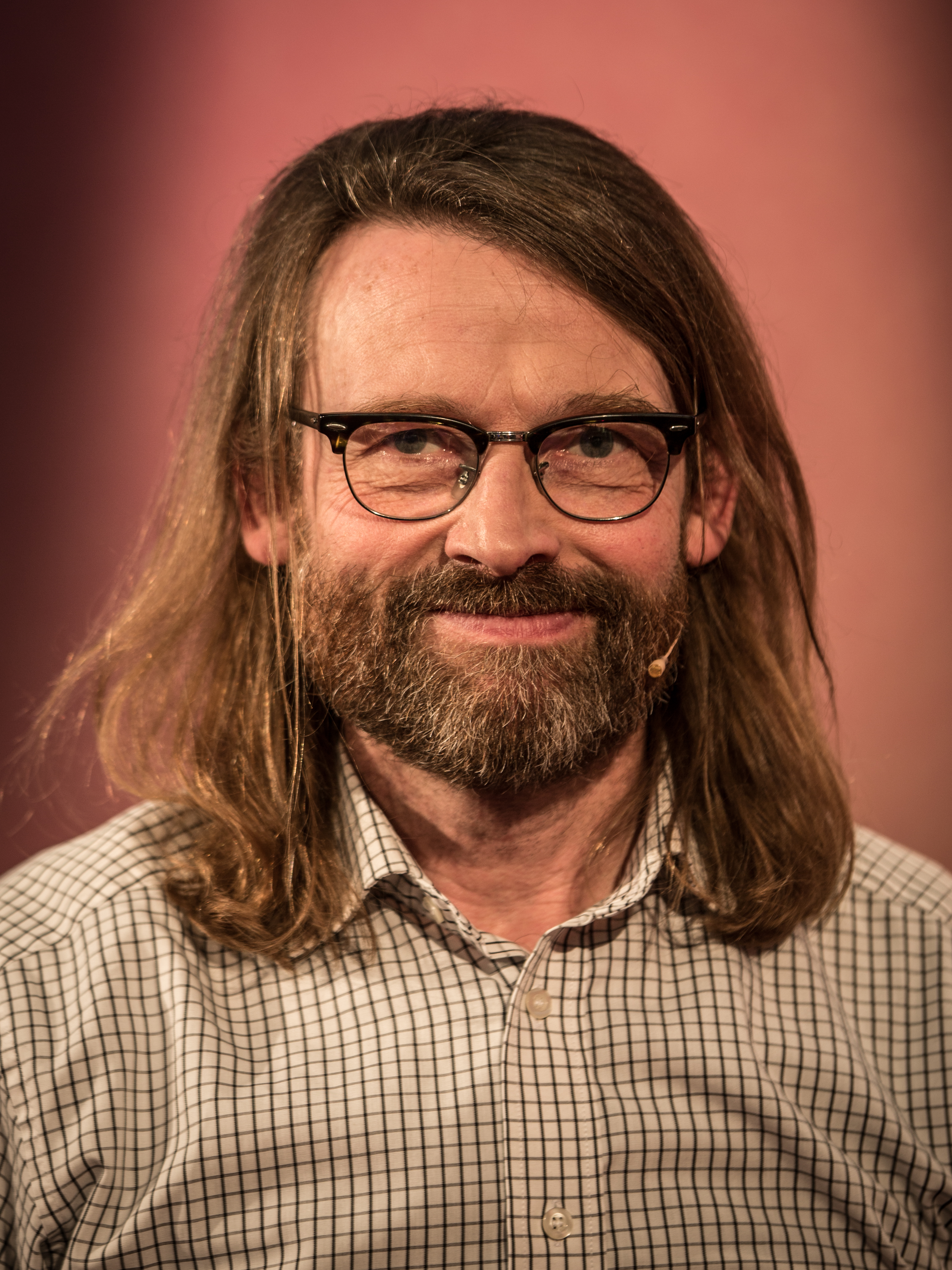Der Roman "Innerstädtischer Tod" von Christoph Peters darf weiter erscheinen. Das hat das Landgericht Hamburgentschieden und einen Antrag auf einstweilige Verfügung des Berliner Galeristen Johann König und seiner Frau Lena ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen.
Damit scheiterten die Antragsteller mit dem Versuch, dem Luchterhand Literaturverlag die Verbreitung des Buchs oder einzelner Passagen daraus zu untersagen. Gericht erkennt Übereinstimmungen – aber keine Rechtsverletzung
Zwar stellte das Gericht fest, dass König und seine Frau aufgrund der Übereinstimmungen zwischen ihnen und den Romanfiguren Konrad und Eva-Kristin Raspe für einen Teil des Leserkreises erkennbar seien. Doch das allein reiche nicht für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Kunstfreiheit falle daher zugunsten des Verlags aus.
Der bereits im vergangenen September beim Luchterhand Literaturverlag erschienene Roman spielt im Jahr 2022 in Berlin. Im Mittelpunkt steht der Nachwuchskünstler Fabian Kolb, der große Hoffnungen auf seine erste Ausstellung in der Galerie Konrad Raspe setzt – eine der ersten Adressen der Hauptstadt. Raspe selbst hat jedoch einen zweifelhaften Ruf.
Kein Schlüsselroman – klare Abgrenzung zu "Esra"
Peters hat dem ersten Kapitel seines Buches den Hinweis vorangestellt: "Dieses Buch ist ein Roman." Weiter heißt es: "Als literarisches Werk knüpft es in vielen Passagen an reales Geschehen und an Personen der Zeitgeschichte an." König und seine Frau sahen sich dadurch in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt.
Nach Auffassung der Kanzlei König handelt es sich bei "Innerstädtischer Tod" um einen Schlüsselroman mit realen Vorbildern für zentrale Figuren – bis hin zu Details wie der in einer früheren Kirche untergebrachten Galerie. Johann König betreibt seine Galerie tatsächlich in einer ehemaligen katholischen Kirche in Berlin.
Die Kanzlei, die den Verlag vertritt, widerspricht: Das Werk sei kein Schlüsselroman, die Figuren seien fiktiv. Persönliche Eigenschaften, Alter, Aussehen, Vita und familiäres Umfeld unterschieden sich grundlegend von den Antragstellern. Auch die Annahme, dass Eva-Kristin Raspe ein Abbild von Königs Frau sei, sei abwegig.
Vergleich mit dem Fall "Esra"
Der Fall erinnert an die Diskussionen um das Spannungsverhältnis von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten im Zusammenhang mit Maxim Billers Roman "Esra". Nach einem jahrelangen Rechtsstreit untersagte das Bundesverfassungsgericht 2007 das Erscheinen des Romans endgültig. Das Buch verletze das Persönlichkeitsrecht von Billers Ex-Freundin, weil sie eindeutig als "Esra" erkennbar sei und der Roman intimste Details aus der Beziehung schildere.
"Innerstädtischer Tod" sei mit "Esra" jedoch nicht vergleichbar, betont der Verlag. Während "Esra" aufgrund einer Vielzahl individueller Details auf tatsächlichen Begebenheiten beruhe, sei Peters' Roman eindeutig fiktional. Das Gericht schloss sich dieser Einschätzung an: "Die Leser würden nicht ohne Weiteres vermuten, dass der Autor wahre Begebenheiten schildert, auch wenn einzelne Figuren an reale Personen angelehnt sind."
Hat sich König mit der Klage ein Eigentor geschossen?
Für den Literaturwissenschaftler Johannes Franzen ist die Entscheidung nicht nur eine Niederlage für König, sondern könnte sich als PR-Coup für den Verlag erweisen. "Der Verlag hat natürlich sofort angefangen damit Werbung zu machen, weil nichts ist ein größerer aufmerksamkeitsökonomischer Gewinn als ein zünftiger Skandal."
Zwischen Kunst, Politik und moralischer Krise
Es ist der 9. November 2022, die Welt steht im Schatten des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der aufstrebende Künstler Fabian Kolb soll an diesem Abend seine erste große Einzelausstellung in der renommierten Berliner Galerie Konrad Raspe eröffnen. Seine Familie reist extra aus Krefeld an, Eigentümer der letzten verbliebenen deutschen Krawattenmanufaktur, und jeder hat seine eigenen Hoffnungen in dieses Ereignis gesetzt. Sein Onkel Hermann Carius, ein alternder Chefideologe der Neuen Rechten im Bundestag, denkt über einen medienwirksamen Auftritt nach. Fabians Vater sieht die Gelegenheit, über seinen politisch gut vernetzten Schwager weiterhin Ware nach Russland zu exportieren.
Während sich die Gäste im Scheinwerferlicht der Kunstwelt versammeln, wächst in Fabian ein ungutes Gefühl. Ist er bereit, sich auf all die Kompromisse einzulassen, die mit einer internationalen Karriere verbunden sind? Die Zweifel werden noch drängender, als er erfährt, dass sein Galerist Raspe plötzlich im Fokus schwerer Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiterinnen steht. Die schillernde Kunstszene Berlins verwandelt sich in ein Minenfeld aus politischen Intrigen, ökonomischen Interessen und moralischen Abgründen.
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
Fiktion auf der Anklagebank: "Innerstädtischer Tod" zwischen Kunstfreiheit und Justiz
Gegenposition: Offener Brief für "kontinuierliche" Waffenlieferungen an die Ukraine
Der Sandkasten
„Shitbürgertum“ von Ulf Poschardt
Annett Gröschner wird Mainzer Stadtschreiberin 2025
Ein Geburtstagskind im November: Anna Seghers
Jacek Dehnel verlässt Berlin und kehrt nach Warschau zurück: Scharfe Kritik an Deutschland
Antonio Skármeta ist tot: Der chilenische Schriftsteller wurde 83 Jahre alt
Verlag Eksmo-AST nimmt letzten Teil der Doktor Garin - Trilogie aus dem Programm
"Hannah-Arendt-Preis" für den ukrainischen Schriftsteller Serhij Schadan
Wer ist Wolodymyr Selenskyj? Biografische Bücher über den ukrainischen Präsidenten
Intellektuelle fordern: "Waffenstillstand jetzt!"
Peter Sloterdijk zum Ukraine-Krieg: "Man hört kaum noch Gegenstimmen"
Russischer Schriftsteller Dmitry Glukhovsky zur nationalen Fahndung ausgeschrieben
Natascha Wodin erhält Joseph-Breitbach-Preis 2022
Aktuelles
„Mama, bitte lern Deutsch“ von Tahsim Durgun – TikTok trifft Literatur
Abschied: Peter von Matt ist tot
»Gnade Gott dem untergeordneten Organ« – Tucholskys kleine Anatomie der Macht
Ein Haus für Helene

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz
Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür
„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt
„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft
„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note
Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab
UNESCO und IBBY sammeln Werke in indigenen Sprachen
Mario Vargas Llosa ist tot –Ein Abschied aus Lima
Rezensionen
Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft
Guadalupe Nettel: Die Tochter
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen