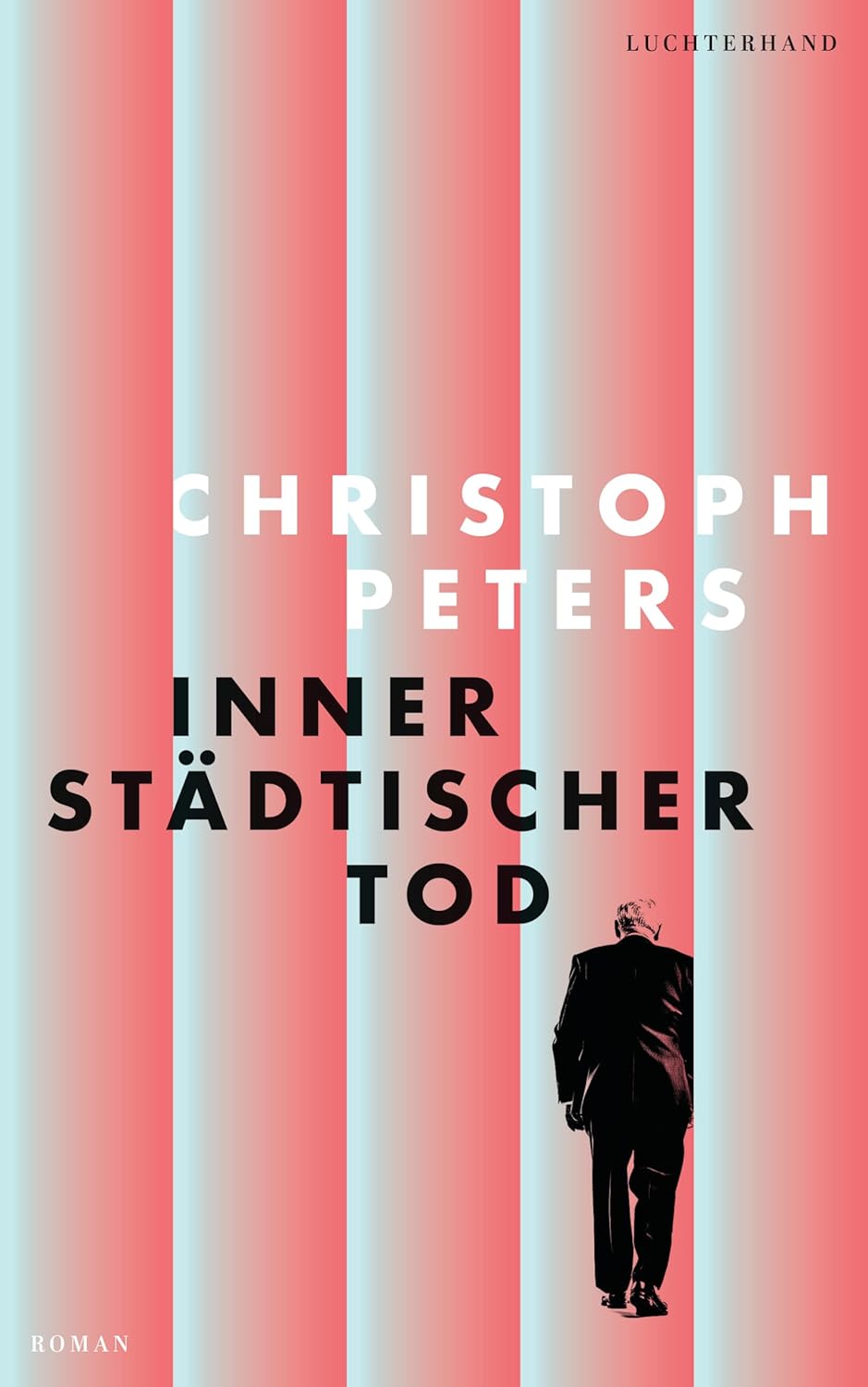Der Fall König vs. Peters entwickelt sich zu einer Grundsatzdebatte über die Grenzen der Kunstfreiheit und den Schutz der Persönlichkeitsrechte in der Literatur. Der Roman "Innerstädtischer Tod" von Christoph Peters steht im Zentrum eines möglichen juristischen Präzedenzfalls, dessen Ausgang weitreichende Folgen für Autorinnen und Autoren haben könnte.
Fiktion auf der Anklagebank: "Innerstädtischer Tod" zwischen Kunstfreiheit und Justiz
Ein Roman als Angriff auf Persönlichkeitsrechte?
Johann König, einer der bekanntesten Galeristen Deutschlands, sieht sich in der Romanfigur Konrad Raspewidergespiegelt. Gemeinsam mit seiner Frau Lena hat er eine einstweilige Verfügung gegen den Luchterhand Verlag beim Landgericht Hamburg beantragt. Das Ziel: die weitere Verbreitung des Romans zu unterbinden und jegliche Veröffentlichung seines Inhalts zu verhindern. Im Falle eines Verstoßes werden zwei Mal 250.000 Euro Ordnungsgeldverlangt.
Die Parallelen zwischen König und der Romanfigur sind laut FAZ-Autor Andreas Platthaus (FAZ, 8. Februar 2025)offensichtlich – aber keineswegs deckungsgleich. Wie König betreibt Raspe eine Galerie in einer umgebauten Kirche in Berlin, gerät jedoch durch angebliche Affären mit Mitarbeiterinnen ins Zentrum eines MeToo-Skandals. Auch prominente Figuren aus dem Kunstbetrieb tauchen unter anderen Namen auf. Dabei bemühe sich Peters laut Platthaus um eine Verfremdung, sodass sich die Figuren nicht eins zu eins mit realen Personen gleichsetzen lassen.
Zwischen Kunst, Politik und moralischer Krise
Es ist der 9. November 2022, die Welt steht im Schatten des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der aufstrebende Künstler Fabian Kolb soll an diesem Abend seine erste große Einzelausstellung in der renommierten Berliner Galerie Konrad Raspe eröffnen. Seine Familie reist extra aus Krefeld an, Eigentümer der letzten verbliebenen deutschen Krawattenmanufaktur, und jeder hat seine eigenen Hoffnungen in dieses Ereignis gesetzt. Sein Onkel Hermann Carius, ein alternder Chefideologe der Neuen Rechten im Bundestag, denkt über einen medienwirksamen Auftritt nach. Fabians Vater sieht die Gelegenheit, über seinen politisch gut vernetzten Schwager weiterhin Ware nach Russland zu exportieren.
Während sich die Gäste im Scheinwerferlicht der Kunstwelt versammeln, wächst in Fabian ein ungutes Gefühl. Ist er bereit, sich auf all die Kompromisse einzulassen, die mit einer internationalen Karriere verbunden sind? Die Zweifel werden noch drängender, als er erfährt, dass sein Galerist Raspe plötzlich im Fokus schwerer Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiterinnen steht. Die schillernde Kunstszene Berlins verwandelt sich in ein Minenfeld aus politischen Intrigen, ökonomischen Interessen und moralischen Abgründen.
Literarisch ist der Roman Teil einer Trilogie, die sich an Wolfgang Koeppens Werke anlehnt. Peters nutzt Techniken der verfremdeten Zeitkritik, um eine Geschichte über Macht, Kunst und moralische Ambivalenz im heutigen Berlin zu erzählen. Dabei folgt er einem literarischen Prinzip, das seit Jahrhunderten zur Fiktion gehört: die Umformung realer Ereignisse in literarische Strukturen.(Leseprobe)
Kunstfreiheit gegen juristische Realität – der Fall "Esra" als Präzedenz?
Die Berliner Kanzlei Schertz Bergmann, die für König agiert, stützt sich auf den berühmten Fall "Esra", bei dem Maxim Billers Roman 2003 wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten verboten wurde. Das Bundesverfassungsgericht entschied damals, dass die Identifizierbarkeit einer realen Person in einem Roman einen unzulässigen Eingriff in deren Privatsphäre darstellt. Seitdem gilt dieses Urteil als umstrittenes Beispiel für eine Einschränkung der Kunstfreiheit.
Sollte das Landgericht Hamburg den Antrag von König stattgeben, könnte dies eine Verschärfung der juristischen Kontrolle über fiktionale Werke nach sich ziehen. Falls der Verlag Luchterhand in Berufung geht, ist eine Entscheidung bis zur letzten Instanz nicht ausgeschlossen.
Entscheidung bis zum 10. Februar erwartet
Bis zum 10. Februar hat der Verlag Luchterhand Zeit zur Stellungnahme. Das Gericht kann den Antrag sofort stattgeben, zurückweisen oder eine öffentliche Verhandlung ansetzen. Die Frage bleibt: Wird "Innerstädtischer Tod" verboten oder bleibt die literarische Kunstfreiheit gewahrt?
Ästhetik der Gegenwartsliteratur
Über die inhaltliche Brisanz hinaus betont Denis Scheck (ARD, "Druckfrisch") die sprachliche Qualität des Romans. Peters gelingt es, die hohle Rhetorik von Politik, Medien und Kunstbetrieb zu sezieren und literarisch produktiv zu machen. Die Kombination aus Ironie, analytischem Scharfsinn und gesellschaftlicher Tiefenschärfe macht das Buch für ihn zu einem echten Denkvergnügen.
Die juristische Dimension und die mediale Debatte
Ironischerweise scheint das Buch genau jene Debatten auszulösen, die es thematisiert: Wo endet Fiktion, wo beginnt Persönlichkeitsverletzung? Die Klage von Johann König könnte Innerstädtischer Tod endgültig zum Politikum machen. Sollte das Gericht den Vertrieb untersagen, wäre das nicht nur ein juristisches, sondern auch ein literaturpolitisches Signal.
Lesebefehl oder umstrittenes Experiment?
Mit seiner Empfehlung von Innerstädtischer Tod positioniert Denis Scheck (ARD, "Druckfrisch") Christoph Peters' neuen Roman als ein Werk von politischer und gesellschaftlicher Relevanz. Dass das Buch auch juristisch umkämpft ist, verstärkt diesen Eindruck nur noch.
Scheck sieht darin einen Schlüsselroman, der das politische Berlin und die Dynamiken von Rechts- und Linkspopulismus, Korruption und MeToo-Debatten in den Kunstbetrieb einbindet. Besonders brisant: Der Roman zeichnet die Verflechtung rechter Ideologie mit russischen Einflussnahmen nach. Eine Thematik, die spätestens nach den Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland und den Enthüllungen über rechte Netzwerke hochaktuell ist. Ob der Roman tatsächlich eine neue Perspektive auf das politische Berlin eröffnet oder eher bekannte Narrative bedient, wird sich zeigen. Fest steht: Diese Debatte wird nicht nur in Gerichtssälen, sondern auch in Feuilletons weitergehen.
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
Christoph Peters "Innerstädtischer Tod" darf weiter erscheinen
Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab
Die Bestenliste mit Augenzwinkern – Denis Scheck kuratiert die literarische Wirklichkeit
Der Sandkasten
Denis Scheck über die Spiegel-Bestsellerliste
Gegenposition: Offener Brief für "kontinuierliche" Waffenlieferungen an die Ukraine
"Druckfrisch" mit Denis Scheck: Heimat und Herkunft
Denis Scheck feiert 100. Sendung "lesenswert"
"Druckfrisch" mit Denis Scheck - Yakuza, Fanta und große Stimmen
Aktuelles

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott
Claudia Dvoracek-Iby

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam
Claudia Dvoracek-Iby

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.
Marie-Christine Strohbichler

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz
Pawel Markiewicz
„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit
„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch
„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks
„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe
Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür
„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch
Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen
„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt
„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft
„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note
Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab
Benedict Pappelbaum
Rezensionen
Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft
Guadalupe Nettel: Die Tochter
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen