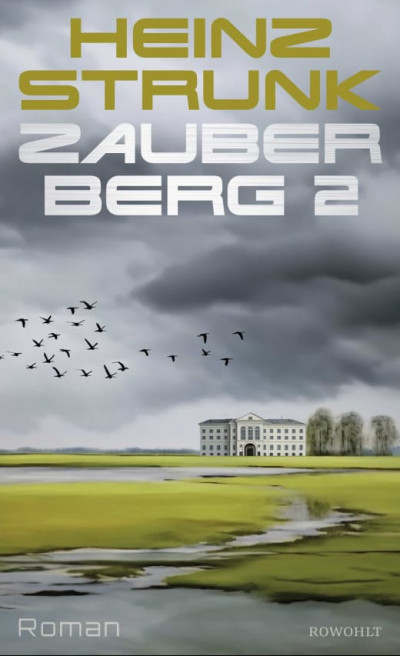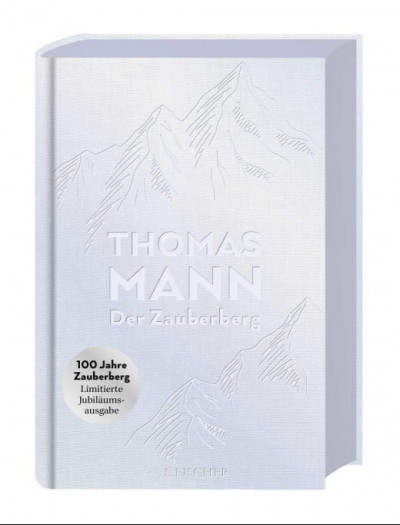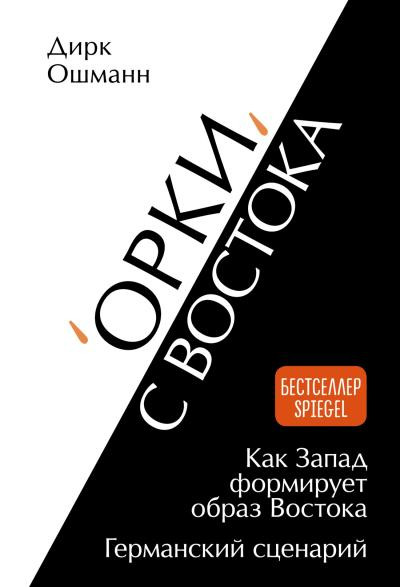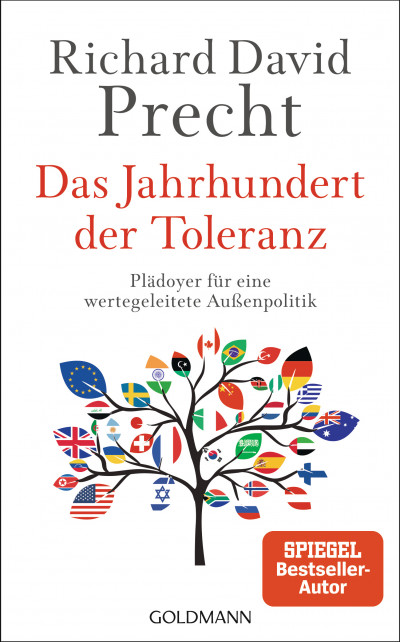Für ihren Roman "Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron" wurde die Autorin Yade Yasemin Önder am vergangenen Samstag mit dem lit.Cologne-Debütromanpreis ausgezeichnet. Inhaltlich ist dieser Text nur schwer zu fassen. Haltlos bewegen wir uns zwischen unvermittelt aufblitzenden Szenen, deren Bilder zwar gleichnishaft anmuten sollen, über die konkrete Beschreibung aber nicht hinausgehen. Die Atemlosigkeit, die man dem Roman als positives Attribut mehrmals bereits anheftete, ist nicht viel mehr als das Resultat einer ungelenken Sprache, die sich in Wortkaskaden zu retten versucht. Eine Enttäuschung.
Und wieder wird gelitten. Auf der Höhe unserer Zeit schwingen die Erniedrigten und Beleidigten eindrucksvoll ihre Zepter, während die Feuilletons - vermutlich aus Zeitmangel - halbgelangweilt dazu applaudieren. Yade Yasemin Önder´s Roman "Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron", der am Samstag mit dem lit.Cologne-Debütromanpreis ausgezeichnet wurde, steht paradigmatisch für eine Literatur, die man mit Vladimir Nabokov als "Seelensuche in Selbstentblößung" bezeichnen kann. Nabokov bezog sich mit seiner Äußerung damals kritisch auf Fjodor Dostojewskies Roman "Schuld und Sühne"; ein Roman, der auf psychologische Weise eine Frage öffnete, die zur größten des 20. Jahrhunderts werden sollte: Gibt es unwertes Leben, das zugunsten eines wertvolleren ausgelöscht werden darf?
Während die von Nabokov damals so bezeichnete "Seelensuche" also noch an existenziellen und universellen Grundfragen rührte, haben wir es heute vermehrt mit Seelensuchen zu tun, die sich mit dem einfachen Herunterschreiben eigener Erfahrung und Begegnungen begnügen. Der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler hatte für diese Art Literatur unlängst den Begriff des "neuen Midcult" vorgeschlagen. Im Grunde wird hier nicht gesucht, sondern Gefundenes auf möglichst rohe, brachiale Weise dargestellt in der Hoffnung, der mediale Diskurs würde die Texte auf unsichtbarer Hand ganz von selbst in die heiligen Hallen der Gegenwartsliteratur befördern. Allzu oft ist es dabei eben so, dass sich rein gar nichts Literarisches an diesen literarischen Verarbeitungen individueller Identitätsfragen finden lässt. Stattdessen verlassen sich die Autorinne und Autoren schlicht auf die Empathie ihrer Leser. Die Empathie der Leser aber, kann kein literarisches Qualitätsmerkmal sein. Auch anrührende, gefühlige Texte können schlecht gearbeitet sein. Mit Blick auf die vergangenen Jahre muss man hinzufügen: Im Genre der "Selbstentblößung-Literatur" gibt es nur wenige rühmliche Ausnahmen, wie etwa Ocean Vuong oder Édouard Louis.
Entblößung und Identitätssuche
Wie in Yade Yasemin Önder´s Roman sind es in den Büchern dieser Entblößungs-Literatur oft schlichte, einfache Bildern, die roh ausgestellt werden und deren Monstrosität - so wohl die Hoffnung- genügen muss, um beeindrucken zu können. In "Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron" ist das beispielsweise die in eine Kreissäge geratene Hand des Vaters, sowie das darauffolgende Erbrechen der Tochter in Richtung des sich noch drehenden Sägeblatts. "Schwer wie Steine" fällt dort das in "klitzekleine Bröckchen" geschnittene Erbrochene auf den regungslos am Boden liegenden Vater nieder, von dem die Tochter auch im Rückblick nicht genau sagen kann, ob er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Erzählt wird diese Passage so, wie Kleinkinder Geschenke aufreißen. Schnell die abgeschnittenen Finger, das spritzende Blut, die traumatische Begegnung, damit die Figur Konturen bekommt. Eine Minute nach Lesebeginn wünscht man sich so bereits einen Weichzeichner, schriftstellerische Souveränität, Ruhe, mehr als nur eine schlichte Variation der Alltagssprache, in der einem ein allzu großes Bild vor die Füße "gekotzt" wird.
Von diesem Vatertot - der sichtbar als Vatermord gekennzeichnet ist - geht es weiter in die Leidensgeschichte einer jungen Frau, deren schwierige Beziehung zur Mutter mehr oder wenige das Letzte ist, was ihr an familiärem Miteinander noch bleibt. Einsam und unpassend fühlt sich die Protagonistin. Die Welt tritt als fremd und kalt in Erscheinung, hinter jeder Ecke lauert Niedergang und Unverständnis. Die Zerrissenheit der Ich-Erzählerin findet sich - selbstverständlich - ebenso im fragmentarischen Plot wie in der zuweilen zersprengten Sprache wieder, die wohl nicht wenige Leserinnen und Leser als eine lyrische missverstehen werden.
Die gestörte Weltbeziehung der Protagonistin, die sich im Laufe der Geschichte vielerorts manifestiert, ist auf die Familienkonstellation zurückzuführen. Sie selbst bezeichnet sich als "Mischling" aus türkischem Vater und deutscher Mutter. Zu dritt bilden sie eine dysfunktionale Familie, aus deren Nicht-Zusammkommen bald schon unterschiedlichste Symptome erwachsen, die auf die Protagonistin niederschlagen. Sie erkrankt an Bulimie, kommt in eine Reha-Einrichtung, lässt sich vorzeitig entlassen, stürzt ab und tritt später eine Reise an, die alles verändern wird. Bis dato schlafwandelt sie durch diverse Exzesse, auf der Suche nach sich selbst und einem Grund, weiterzumachen.
Wenn es für Twitter nicht reicht...
Das große Thema in Yade Yasemin Önder´s Roman ist also zweifellos die Identitäts-Suche. Ein Topos der Weltliteratur, und gerade deswegen - insbesondere literarisch - so viel schwieriger zu bearbeiten, als es Twitter und andere Soziale Plattformen tagtäglich nahelegen. Vielleicht sollte man, angesichts der inflationär auf den Markt geworfenen Coming-of-Age-Geschichten, noch einmal deutlich machen, dass nicht jede Erinnerung, die mehr Zeichen benötigt als ein Twitter-Tweet vorgibt, Buch werden muss. Sich schriftstellerisch dem Thema Identität zu widmen ist löblich. Hier aber, überzeugt die Umsetzung nicht. Leider ist Yade Yasemin Önder damit keineswegs ein Einzelfall.
Yade Yasemin Önder - "Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron"; Kiepenheuer & Witsch, 2022, 256 Seiten, 20,00 €