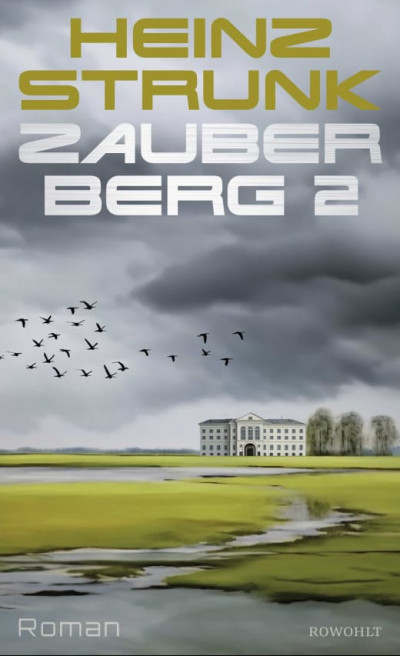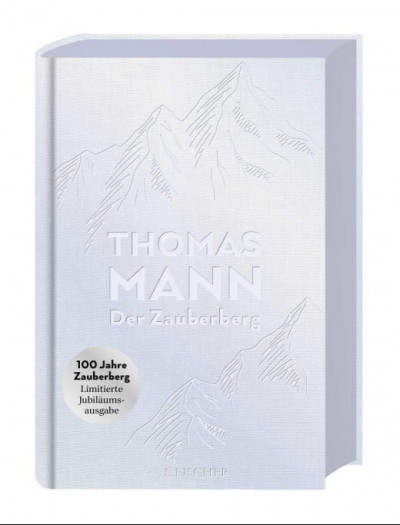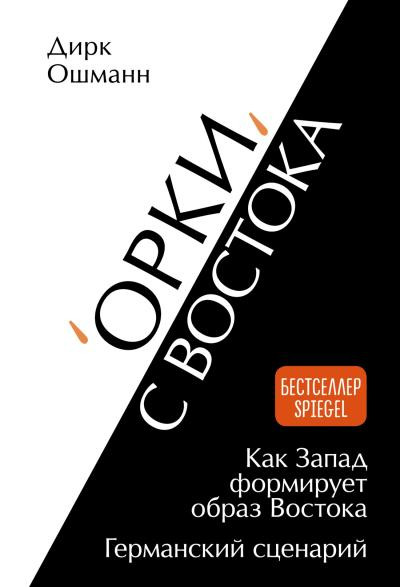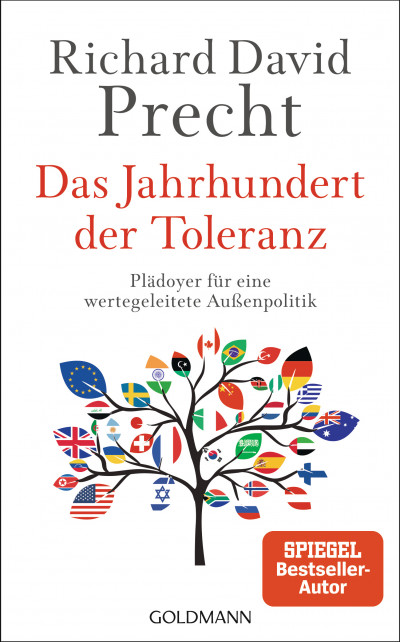Die Corona-Pandemie brachte uns nicht nur Nöte, Sorgen und Ängste, sondern auch das nette Wörtchen Resilienz, welches schnell von Talkshow zu Talkshow getragen und bald schon fester Bestandteil selbst der alltäglichsten Gespräche wurde. Gemeint ist damit psychische Widerstandsfähigkeit, sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche. Resilient ist also, wer auf unvorhersehbare Probleme adäquat reagieren und sich veränderten Bedingungen möglichst geschmeidig anpassen kann. Wir sprechen also nicht von psychischer Abgestumpftheit oder gar Ignoranz, sondern von der Fähigkeit, möglichst dynamisch auf Katastrophales zu reagieren. Vielleicht ahnt man bereits: Resilienz ist nicht so weit vom Begriff der Sensibilität entfernt, wie man zunächst annehmen möchte. So macht es auch die Philosophin Svenja Flaßpöhler in ihrem aktuellen Buch "Sensibilität" klar. "Resilienz", sagt Flaßpöhler, "ist nicht die Feindin, sondern die Schwester der Sensibilität."
Sensibilität scheint das Thema der Stunde zu sein. Der kleinste Fehlgriff sorgt für Erregung, ein falsches Wort für Aufsehen, eine Nicken für Empörung. "Was sind das für Zeiten", will man mit Berthold Brecht fragen, "wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!" Svenja Flaßpöhler, Autorin der Streitschrift "Die potente Frau" und Chefredakteurin des "Philosophie Magazins", hat ein Buch geschrieben, in welchem sie sich eingehender mit "diesen Zeiten" beschäftigt. Flaßpöhler schreibt über "Empfindlichkeit" und die "Grenzen des Zumutbaren"; schreibt in eine hocherregte Zeit hinein, in der die eigene Verletzlichkeit zunehmend zu einem identitätsstiftenden Faktor wird und Menschen sich nicht selten über das definieren, was sie nicht sind: Nicht weiß, nicht männlich, nicht heterosexuell...
Wer Flaßpöhlers 2018 erschiene Streitschrift "Die potente Frau" noch im Sinn hat, wird wissen, dass Flaßpöhler dieser auf das eigene Defizit zielenden Bewegung skeptisch, wenn nicht feindlich gegenübersteht. Allein: Der emphatische Verweis auf das Defizitäre als das Identitätsstiftende, setzt das, was mich ausschließt, als Absolutes. Flaßpöhler argumentierte damals bereits dagegen, prangert an, dass mit der #MeToo-Debatte eine Dynamik in Gang gesetzt wurde, die patriarchale Strukturen reproduziere. Die Frau als Opfer, der Mann als Täter. Der Mann handelnd, die Frau empfangend. Der Mann redend, die Frau schweigend. Reden tut die Frau in dieser Dynamik erst dann, wenn sie auf das männlich Gesprochene antwortet. Sie selbst hat nichts zu sagen.
Fraglos gab es in den bekannten Fällen - der Weinstein-Skandal und ähnliche - eine klare Opfer-Täter-Verteilung. Und das diese Übergriffe scharf verurteilt gehören weiß auch Svenja Flaßpöhler. Die Frage aber bleibt, ob man diese - ja durchaus männlich gesetzte - Anordnung weiterspielt, öffentlich reproduziert und kollektiviert, oder ob sich die vermeidlichen Opfer, die Frauen, selbstermächtigen und aus ihrer Opferrolle heraustreten sollten. Flaßpöhler betrachtet weniger die einzelnen Fälle, sondern fragt mit Blick auf die Gesellschaft, wie es zu diesen kommen konnte und wie sie im Nachhinein öffentlich behandelt werden.
"Sensibel" ist mehr als MeToo
Auch in ihrem aktuellen Buch greift die Philosophin einige dieser bereits in früheren Schriften gesetzten Annahmen wieder auf. "Sensibel" ist aber mehr als nur eine argumentative Weiterführung der "potenten Frau", mehr als eine nächste Aufforderung zur Selbstermächtigung. Vielmehr versucht Flaßpöhler hier die aktuelle - und während Corona noch gesteigerte - gesellschaftliche Erregtheit philosophisch in den Blick zu nehmen. Sie will, wie sie schreibt, "einen Schritt zurücktreten".
Auf den ersten Seiten erscheint dabei des Öfteren der Soziologe Norbert Elias, später kommen weitere Denker wie der Empirist David Hume und Jean-Jacques Rousseau hinzu. Friedrich Nietzsche tritt als Protagonist auf, der uns, aus heutiger Perspektive, als Hybrid erscheinen muss: Ein hochsensibler Typus, der zugleich auf rigorose und radikale Weise danach verlangte, sich selbst zu erheben, die moralischen Laster - das menschliche, allzu menschliche - abzuschütteln. Auch Ernst Jünger, Judith Butler und Michel Foucault kommen zu Wort.
Dialektischer Umschlag
Der Zuwachs an Sensibilität - daran zweifelt Flaßpöhler keine Sekunde - brachte einen enormen zivilisatorischen Fortschritt mit sich. Doch gibt es auch hier einen Umschlagpunkt, einen dieser berühmten Tipping Points, an dem das bis Dato Konstruktive plötzlich einen destruktiven Charakter annimmt. Diesen Punkt, so Flaßpöhler, hätten wir bereits erreicht. "Anstatt zu verbinden, trennt uns die Empfindlichkeit." Aus der eigenen Empfindlichkeit, die im Grunde längst zu einer Überempfindlichkeit geworden ist, wird dann eine Axt gegen Andere. Am heftigsten schlägt sich dieser Umbruch in vielen Fällen der sogenannten Cancel Culture nieder. Doch auch dort, wo die Verwendung des generischen Maskulinums bereits als Angriff empfunden, und also jedes Wort als potenziell disqualifizierendes beäugt wird, ist er deutlich spürbar. Ein Diskurs wird dadurch zunehmend schwieriger, jeder Satz zu einem Geflecht aneinander gefügter, den Sprecher entlarvender Wörter, ein Gespräch zu einem Auf-der-Lauer-liegen gegen den Anderen.
Hier erkennt Flaßpöhler einen klaren und doch Widerspruch. Die einst demokratische Absicht, auf Minderheiten aufmerksam zu machen und diese strukturell zu berücksichtigen, wird mit zuweilen totalitären, undemokratischen Mitteln umgesetzt. Mittel und Zweck widersprechen also einander, der Weg fällt dem Ziel zum Opfer. Auch an der oft bemühten "gesellschaftlichen Struktur" ändert sich dabei nicht viel, die bestehenden Gegenpole werden beibehalten, nur eben vertauscht. So wirft man sich selber Stöcker in den Weg, stolpert, und sucht den Grund fürs Fallen uneinsichtig bei den Anderen. Eine verpasste Chance. Denn gerade das Aufdecken und Anerkennen der eigenen Widersprüche könnte konstruktiv und produktiv sein; kratzt dieser doch an der moralisch reinen Weste, die man der "Sprachpolizei" gern oft überwirft.
Resilienz und Sensibilität
Wo also ansetzen? Re-sensibilisieren oder Resilienz stärken? Auch wenn Flaßpöhler diese beiden Begriffe zunächst als Gegensatzpaare einführt, macht sie gegen Ende ihres Buches doch deutlich, dass die "Resilienz" nicht etwa die "Feindin, sondern die Schwester der Sensibilität" sei. "Die Zukunft meistern können sie nur gemeinsam". Mehr noch sieht die Philosophen hier das Potenzial einer dialektischen Aufhebung, nämlich dann, "wenn es gelänge, die Resilienz mit der Kraft der Empfindsamkeit in ein Bündnis zu bringen ...". Dann "wäre der Konflikt, der gegenwärtig die Gesellschaft spaltet, in etwas Drittem aufgehoben".
Die beiden Begriffe gegeneinander auszuspielen bringe wenig und enthalte sogar gefährliches Potential. Denn wer sich dezidiert auf eine Seite schlägt, neigt zur Verabsolutierung. Sowohl "verabsolutierte" Resilienz als auch Hypersensibilität trennen allerdings eher, als sie zusammenführen.
Am Ende hat Svenja Flaßpöhler ein leicht verständliches, anstoßendes und sicher auch an einigen Stellen provozierendes (nicht aber polemisierendes) Buch geschrieben, welches hie und da sicher stärker ins Detail hätte gehen können, als Aufschlag allerdings genügt. Gerade der Widerspruch zwischen demokratischer Absicht und oft undemokratischen Mitteln leuchtet ein. Hier wäre eine Reflexion auf den globalen Kapitalismus interessant gewesen, die Produkt-Besessenheit jener, die da hypersensibel ihre Urteile sprechen, zugleich aber resistent zu sein scheinen wenn es darum geht, woher all die Geräte stammen, die sie benötigen, um urteilen zu können. "
Svenja Flaßpöhler: "Sensibel: Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren"; Klett-Cotta, 202, 240 Seiten, 20 Euro