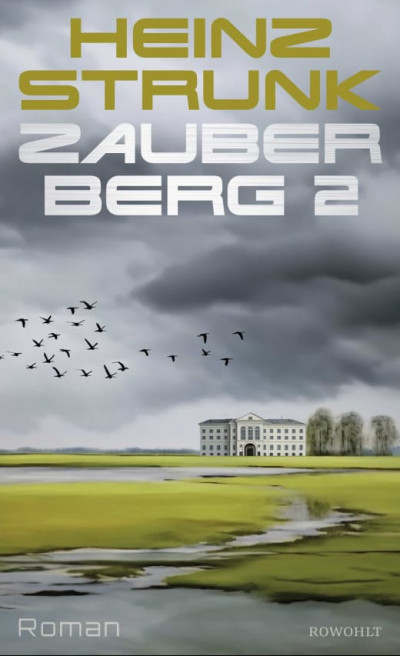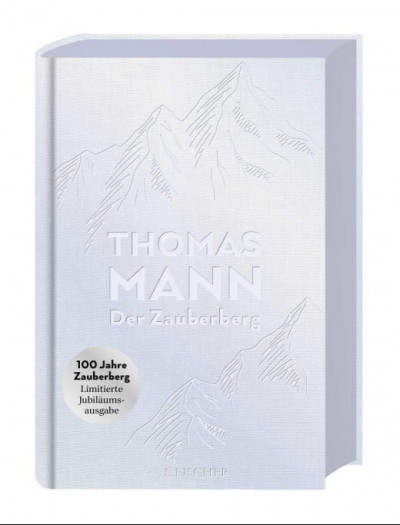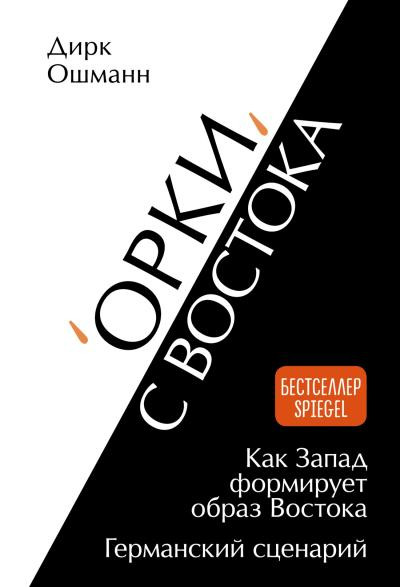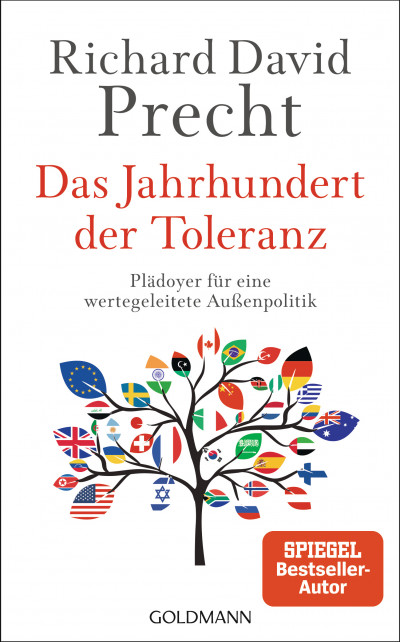Ein großes Thema der europäischen Romantik, der Doppelgänger, vielleicht sogar noch der künstlich hergestellte Doppelgänger, wird hier mit dem Vokabular des amerikanischen Aktionskinos durchbuchstabiert und im Genre des Agententhrillers plaziert – dramaturgisch etwas fragwürdig, aber auf dem neuesten Stand der Technik, geradezu zukunftsweisend.
Klone morden besser – Will Smith besteht die Konkurrenz zu seinem jüngeren Ich in "Gemini Man"
Der böse Doppelgänger – die Angst vor dem zweiten Selbst
Die klassische moralisch aufgeladene Doppelgänger-Geschichte ist bekanntlich Stevensons Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auch dort gibt es bereits einen Mörder, der die Verbrechen begeht, derer die bürgerliche Version des Helden nicht fähig ist. In Stevensons Gefolge hat Oscar Wilde im Dorian Gray ebenfalls einen unmoralischen Doppelgänger ausgelagert, der zwar, da als Gemälde imaginiert, nicht unmittelbar handlungsfähig wird, sein Urbild aber psychologisch derart malträtiert, daß am Ende der Selbstmord steht.
Das Drehbuch von Gemini Man reicht bis 1997 zurück, als gerade die Klon-Debatte Wissenschaft und Öffentlichkeit beschäftigte. Heute, da ganz ähnliche Konstellationen unter der Überschrift KI und Robotik aktuell sind, wirkt das Klonkonzept etwas altmodisch, sozusagen frankensteinisch, und ist offensichtlich die schwache Stelle des Drehbuchs. Inzwischen wissen wir, daß das Klonen eines ganzen Menschen weniger leicht als damals vermutet ist. Für die Herstellung oder Verbesserung bestimmter Fähigkeiten nähme man heute eher die Genschere. So mutet also im Film der amerikanische Glaube, auch für einen erstklassigen Scharfschützen sei die Macht der Gene entscheidend, einigermaßen hinterwäldlerisch an.
Vermutlich haben die Autoren selbst gespürt, daß ihr Ansatz nicht ganz auf der Höhe der Zeit (und des Kinos) wäre, und bringen deshalb im Finale noch einen zweiten Klon ins Spiel, der sein Urbild und den ersten Klon nach dessen Konversion vernichten soll. Diese namenlose Kampfmaschine ist sozusagen elternlos aufgewachsen, was heißen soll: ohne Moral und Emotion. Seine Resistenz gegen stärkste Projektile und Feuer ist so transhuman, daß man ihn für einen Maschinenmenschen wie den Terminator hält. Das aber wäre dann doch ein anderer Film – und einer, der weniger überzeugen könnte, weil Superkräfte beliebig sind. Dieser zweite Klon ist ein netter Einfall, mehr nicht.
Kämpfe und Gespräche
Die Verbindung des Klon-Themas mit konventioneller Geheimdienstarbeit ist also dramaturgisch mißglückt, läßt sich aber beiseite schieben, weil Ang Lee die für die Handlung wichtigen menschlichen Begegnungen mit großer Intensität zu gestalten vermag, vor allem, indem er sie als Ruhepunkte inszeniert. Dies betrifft bereits ein wirklich ausgeleiertes Motiv des Agentenfilms, Enttarnung und Konversion eines feindlichen Agenten, in diesem Falle der hübschen Danny, die als Bootsverleiherin dem Scharfschützen und Auftragsmörder Henry eine Wanze ins Boot montiert hat, nach seiner Rückkehr aber sehr schnell mit seinen Verfolgern zu tun bekommt, heftige Kämpfe besteht und danach mit ihm zusammen, sprichwörtlich im selben Boot, die Lebensreise unternimmt.
Das Gespräch der destruktiven Drahtzieher, Clay Verris und Janet Lassiter, in dem massive Fragen von Verantwortung behandelt werden, geht äußerst kultiviert vor sich, Henrys Instruktion durch seinen alten Kollegen Jack auf seiner Jacht als Freundschaftsbesuch, die Aufklärung durch den Russen Juri im Römischen Bad in Budapest wie eine kunsthistorische Analyse. Für die Annäherung von Henry an seinen Klon Junior muß Lee mehr Aufwand treiben und setzt dabei auch das konventionelle Motiv ‚Maximale Feindschaft wandelt sich in Freundschaft‘ ein. Henry muß sich also gegen Juniors Mordabsichten behaupten, eine klassisch ödipale Konstellation, die hier als Motorradrennen inszeniert wird. Daß für diese fulminante Verfolgungsjagd die pittoreske Topographie von Cartagena in Kolumbien mißbraucht wird, entspringt gängiger Praxis im Agentenfilm, wie sie seit Jahrzehnten in den James-Bond-Filmen üblich ist.
Die nächste Stufe der Annäherung in Budapest enthält bereits reflektierende Elemente, auch wenn sie zunächst im Rahmen einer Geiselnahme Dannys durch Junior stattfindet. Dafür hat man passenderweise eine Krypta mit jahrhundertealten Gebeinen als Schauplatz ausgesucht, denn hier soll ja gestorben werden, und aus amerikanischer Sicht wirkt eine solche Funeralkultur natürlich hübsch makaber, jedenfalls exotisch. Henry gelingt es, seinem Klon Zweifel an der Legitimität seiner Abkunft, für die sich Verris eine banale Geschichte ausgedacht hat, zu wecken und die gedankenlose Mordabsicht zu suspendieren. Es bleibt dann immer noch ein heftiger Zweikampf nötig, der ja seit dem klassischen Western die primäre Dialogform des amerikanischen Mannes ist.
Die wichtigste Person dabei kann nicht eingreifen, darf am Ende nur mit einem Warnschuß den Angreifer verscheuchen. Es ist die rechtzeitig befreite Danny, also die Frau, für die sich Henry zu alt fühlt, die aber seinem Klon-Sohn Junior zugedacht sein sollte. So wird die ödipale Konstellation auf verblüffende Weise verdichtet, findet nicht mehr als sequentielle Konkurrenz des Sohnes gegen den Vater um den Besitz der Mutter statt, sondern als gleichzeitiges Werben der beiden Männer um sie und für einander. Die späteren, ruhigen Dialoge zwischen Vater und Sohn entfalten einen eigentümlichen, im Wortsinne beispiellosen Zauber, denn erstmals spricht hier ein Mensch mit seinem eine Generation jüngeren Ebenbild, und der Zuschauer weiß, daß der digitale Klon tatsächlich nach Will Smiths Jugenderscheinung ausgearbeitet und von ihm auch in Bewegung gesetzt wurde.
Spiegelbildlich zur Aufarbeitung der biologischen Abkunft, die Junior einen ethischen und authentischen Vater beschert, wird seine Auseinandersetzung mit seinem sozialen Vater Verris inszeniert, als Demaskierung des Bösen. Die Bestätigung der Klongeburt ist nur die erste Stufe der Desillusionierung, die Verris selbst als kleine Lüge einschätzt, die dem Klon aber als Verrat erscheint. Dies war seinerzeit ein gängiger Einwand gegen die Legitimation des Klonens: der so gezeugte Mensch verdanke sich einem (fremden) Zweck und sei nicht mehr Zweck an sich selbst, wie von I. Kant als Kriterium der Humanität gefordert. Offensichtlich ist die Aufzucht als perfekte Tötungsmaschine im Dienste eines translegalen Geheimdienstes kein legitimierbarer Zweck. Die zweite Stufe der Desillusionierung besteht in Juniors Einsicht, daß der Tötungsauftrag an Henry mit falschen Gründen erteilt wurde. Junior muß sich also von seinem sozialen und institutionellen Vater lösen und eine neue Lebensorientierung finden.
Klon-Soziologie
Daß hier das Klon-Thema arg deformiert wird, ist der Nachteil des Genres, in dem es angesiedelt wird. Ein Geheimdienstchef, der von einer Klonkriegerarmee träumt – wie sie ja schon mal im ‚Krieg der Sterne‘ unterwegs war – und sie auch noch eigenmächtig ins Werk setzt, ist nicht sehr glaubwürdig, um das Mindeste zu sagen. Und daß er seinen ersten Klon auch noch als eigenen Sohn installiert, also gewissermaßen Beruf und Familie verwechselt, zeugt von einer falschen Berufsauffassung, um das Mindeste zu sagen. Daß er diesen Klon ausgerechnet zur Liquidation seines Urbildes ausschickt, obwohl er doch kalkulieren müßte, daß ‚die Bande des Blutes‘ bei der unvermeidlichen Selbsterkenntnis den Auftrag sabotieren werden, ist ein taktischer Fehler, um das Mindeste zu sagen. Geradezu lächerlich mutet seine finale Rechtfertigung im Angesicht des Todes für das Klonprojekt an: die elternlos aufgewachsenen Klone könne man überall auf der Welt als angst- und schmerzfreie Terrorbekämpfer einsetzen und ihr vorhersehbarer Heldentod bringe kein Leid über Herkunftsfamilien. Mit einer solchen, durchaus amerikanischen Argumentation werden heute Entwicklung und Einsatz autonomer Kampfroboter gerechtfertigt.
Der Logik der Macht kann in Amerika nur ein Wert Paroli bieten: das Ideal der Familie. So zeigt Lee am Ende die quasi familiale Konstellation Henry, Junior und Danny verbündet und vereint. Der zweite Klon ist erledigt, der Ziehvater Verris wurde bedachtsam am Leben gelassen, weil er sein ‚Credo des Jago‘ zu verkünden und seinen Tod abzuholen hat. Seine Liquidation erspart Henry seinem Klon-Sohn, weil sie sein restliches Leben überschatten würde. In der Tat ist es angemessener, daß Henry seinen feindlichen Generationsgenossen selbst tötet und dabei gewissermaßen die in vielen Auftragsmorden erreichte moralische (Verdrängungs-)Routine einsetzen kann. Familie soll auch moralische Entlastung für den Nachwuchs sein. Lee schließt für einen amerikanischen Film ungewöhnlich pazifistisch. Junior wird von seiner Geheimdienstkarriere abgebracht, damit er ein Familienleben führen kann, das Henry aufgrund seines Berufes verwehrt geblieben ist. So sieht man den Klon schließlich ganz gewöhnlich auf dem Campus einer Universität, umringt von potenziellen Lebensgefährtinnen und mit der Wahl des passenden Studienfaches beschäftigt.
Künstlerische Qualitäten
Lee gelingt es, das rechte Maß zwischen genreüblichem Aktionismus und kontemplativ-diskursiven Szenen zu finden, die für die Entfaltung der zwischenmenschlichen Konstellationen unerläßlich sind. Dabei ist die 3-D-Technik sicherlich eine Hilfe, weil sie davon abhält, durch zu viele Schnitte und unruhige Szenenauflösung Hektik zu verbreiten. Auch der wohldosierte Einsatz der Musik, die an entscheidenden Stellen eben auch fehlen darf, trägt dazu bei. Lorne Balfe, den man mit etwas Boshaftigkeit als Hans Zimmers Klon – der höflichere Ausdruck wäre Ghostwriter - bezeichnen könnte, beherrscht die einschlägigen Konventionen, also auch die Kunst, ohne Einfälle zu komponieren. Man möchte ihm etwas mehr Mut zur Originalität wünschen dürfen, wenn er immer wieder zum Beginn der Finalcoda von Bruckners 8. Sinfonie, Takt 685-717, ansetzt, ohne dahin zu kommen.
Lees Schauspielerführung hilft über die Probleme des Drehbuches hinweg, und er hat offenbar Will Smith auch die Angst genommen, gegen sein digitales Double alt auszusehen. Tatsächlich sieht er alt aus, trägt das aber mit Fassung, mit quasi väterlicher Nachsicht gegenüber dem Ich, das er einst einmal war.
Lee ist nicht entgangen, daß das Kino selbst auch ein Klon der Wirklichkeit ist und der Zuschauer gewissermaßen auf der Leinwand seinen Klonen beim Leben zusieht. Beide Sphären sind ununterscheidbar, wenn nicht eine Reflexionsebene hinzugefügt wird. Eine Schlachtsequenz wirkt zunächst ganz realistisch, bis Lee seinen Klon als Zuschauer zeigt und das Getümmel als Übung des Gemini-Personals enthüllt. So täuscht euch das Kino, sagt Lee hier.
Die überlegene Technik – so muß Kino sein
Technisch avanciert ist der Film in drei Kategorien: 3-D, hohe Bildfrequenz und Digitaleffekte. Die räumlich-stereoskopische Technik ist zwar nicht mehr neu, gewinnt aber durch die hohe Bildfrequenz erst ihre wünschenswerte Perfektion. Die Tiefe des Raumes kommt durch die zeitliche Tiefe von mindestens 60 Hz (produziert wurde mit 120 Hz) besser zur Geltung.
Die Erhöhung der Bildfrequenz, die ja über viele Jahrzehnte hinweg in der mechanischen Ära bei kargen 24 Hz verharrte, ist erst digital leicht möglich, hat sich aber trotzdem seither nicht nennenswert verbreitet, obwohl sie das Verfahren ist, mit dem wir Kino hinfort erleben wollen. Dies ist kaum eine Frage des technischen Aufwandes, denn die Mehrkosten für die Kamera dürften marginal sein. Auch die begrenzte Anzahl geeigneter Abspielgeräte dürfte kein Problem sein, denn leicht läßt sich eine Version für die Standardbildfrequenz herunterrechnen. Früher war es wohl das Befremden angesichts des gnadenlosen Realismus dieser Technik, das hemmend wirkte und zu manchen regressiven Rechtfertigungsversuchen der alten Technik führte, aber es geht natürlich nicht an, ästhetische Lernfähigkeit von vornherein zu verweigern.
Die 3-D-Technik wird sehr dezent eingesetzt, fällt ebenso wenig auf wie die hohe Bildfrequenz, die beide nur dem Ziel der Natürlichkeit dienen, und wenn auch HDR als erweiterter Farbraum im Spiel sein sollte, wie die Eigenwerbung im Vorspann für Dolby-Vision suggiert, dient sie dem selben Ziel. Nur in zwei Konstellationen merkt man der 3-D-Technik eine verfahrensbedingte Schwäche an: der Puppenstuben-Effekt tritt auf, wenn mit dem Tiefenbudget für einen nahen Vordergrund zugleich ein fernes Panorama abgebildet werden soll, in diesem Falle die Ansicht auf Lüttich, vom Bahnhof aus und diejenige auf das Donauufer Budapests, von einer erhöhten Terrasse aus.
Die Digitaleffekte braucht Lee hier, um einen verjüngten Will Smith als seinen eigenen Doppelgänger einsetzen zu können. Dabei wurde außerordentlich akribisch vorgegangen, wie Paramount bei einem Workshop im Rahmen des IFAplus-Summit im September eingehend demonstrierte. Bis in die verschiedenen Hautschichten und Gesichtsmuskelansatzpunkte hinein wurden große Datenmengen erfaßt und beim Rendern berücksichtigt, so daß ein makellos junger Doppelgänger herauskam. Diese digitale Perfektion ist sicherlich ein Meilenstein, aber nicht unbedingt der Beginn digitaler Schauspielerei als Standardarbeitsvertrag. Gewiß werden sich prominente Schauspieler künftig ihre Persönlichkeitsrechte auch für diesen Fall vorbehalten, um nicht durch einen Motion-Capture-Sklaven weit unter Marktwert auf die Leinwand gebracht zu werden.
Topnews
Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf
Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt
Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte
Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann
Zauberberg 2 von Heinz Strunk
100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können
Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung
Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen
PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten
„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk
Precht: Das Jahrhundert der Toleranz
Jenny Erpenbeck gewinnt Internationalen Booker-Preis 2024
Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich
Romanverfilmung "Sonne und Beton" knackt Besuchermillionen
Asterix - Im Reich der Mitte
Rassismus in Schullektüre: Ulmer Lehrerin schmeißt hin
14 Nominierungen für die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues"
"Die Chemie des Todes" - Simon Becketts Bestsellerreihe startet bei Paramount+
Michel Houellebecq und die "Aufstachelung zum Hass"
Traumarbeits-Agentur
„Johannes Kepler – der Himmelsstürmer“ - Dreharbeiten haben begonnen
Neuer Thriller von Marc Elsberg Helix - Sie werden uns ersetzen
Kerstin Giers Bestseller-Reihe "Silber" wird verfilmt
Doris Dörries "Freibad" startet in den Kinos
Literaturverfilmung "Bullet Train" startet in wenigen Tagen
Zwischen Fortschritt und Aberglaube: Dreharbeiten zu "Hauke Haiens Tod" haben begonnen
Die Welt zu retten ist kein Scherz
Bei der Geisterbeschwörung schlägt das Grauen zu
"Systemsprenger" - Die Deutsche Oscar-Hoffnung
"Das Star Wars Archiv" - Mythen, Macht und Metamorphosen
"Zwischen uns die Mauer" - ZDF-Koproduktion verfilmt Katja Hildebrands autobiografischen Roman
Der rosa Elefant von Martin Suter
„Girl on the Train“ startet Ende Oktober im Kino
Das Pubertier - Dreharbeiten begonnen
Aktuelles

Claudia Dvoracek-Iby: mein Gott
Claudia Dvoracek-Iby

Claudia Dvoracek-Iby: wie seltsam
Claudia Dvoracek-Iby

Marie-Christine Strohbichler: Eine andere Sorte.
Marie-Christine Strohbichler

Der stürmische Frühlingstag von Pawel Markiewicz
Pawel Markiewicz
„Der Gesang der Flusskrebse“ – Delia Owens’ poetisches Debüt über Einsamkeit, Natur und das Recht auf Zugehörigkeit
„Der Duft des Wals“ – Paul Rubans präziser Roman über den langsamen Zerfall einer Ehe inmitten von Tropenhitze und Verwesungsgeruch
„Die Richtige“ von Martin Mosebach: Kunst, Kontrolle und die Macht des Blicks
„Das Band, das uns hält“ – Kent Harufs stilles Meisterwerk über Pflicht, Verzicht und stille Größe
Magie für junge Leser– Die 27. Erfurter Kinderbuchtage stehen vor der Tür
„Die Möglichkeit von Glück“ – Anne Rabes kraftvolles Debüt über Schweigen, Schuld und Aufbruch
Für Polina – Takis Würgers melancholische Rückkehr zu den Ursprüngen
„Nightfall“ von Penelope Douglas – Wenn Dunkelheit Verlangen weckt
„Bound by Flames“ von Liane Mars – Wenn Magie auf Leidenschaft trifft
„Letztes Kapitel: Mord“ von Maxime Girardeau – Ein raffinierter Thriller mit literarischer Note
Drachen, Drama, Desaster: Denis Scheck rechnet mit den Bestsellern ab
Benedict Pappelbaum
Rezensionen
Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft
Guadalupe Nettel: Die Tochter
„Größtenteils heldenhaft“ von Anna Burns – Wenn Geschichte leise Helden findet
Ein grünes Licht im Rückspiegel – „Der große Gatsby“ 100 Jahre später
"Neanderthal" von Jens Lubbadeh – Zwischen Wissenschaft, Spannung und ethischen Abgründen